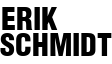Paradise Lost
Dr. Björn Vedder über RETREAT im Kunstraum Potsdam
Der Fotoapparat kann mit Pinsel
und Palette nicht konkurrieren, solange man ihn im
Himmel und in der Hölle
nicht verwenden kann.
Edvard Munk
Erik Schmidt malt Systeme. Das war schon in den ersten Arbeiten so, die das Leben in der Großstadt zeigen, das Nachtleben oder die Banker. Später kamen exotischere Gruppen dazu wie die Occupy-Bewegung oder westfälische Adelige. Ab 2015 gewinnt die Systemmalerei eine neue Qualität, denn Schmidt fängt an, auch eigene Fotos zu übermalen – und nicht nur fremde Bilder. Diese Wendung war ein wenig aus der Not geboren: Schmidt besuchte 2015 Tokyo, und wie immer auf Reisen machte er Fotos. Da er spontan die Einladung zur Teilnahme an einer Ausstellung erhielt und nichts außer den Fotos bei sich hatte, nutzte er diese nicht, wie bisher, als Vorlage für seine Malerei, sondern malte direkt auf die Ausdrucke der Fotografien. Genauer gesagt, malte er bestimmte Elemente der Fotografien nach, gestisch, pastos, tänzerisch; legte seinen Rhythmus über den Rhythmus der Stadt.
Für die zweite Schicht, die sich in Schmidts Arbeiten über die Fotografie legt, gibt es in Bezug auf Texte den Begriff des Palimpsests. Er bezeichnet ursprünglich Pergamente, bei denen die alte Schrift abgekratzt wurde, damit neu darübergeschrieben werden konnte. Das funktionierte jedoch oft nicht gut. Dann schien die alte Schrift durch die neue hindurch und konnte mitgelesen werden. So entstand eine Form von Intertextualität, die seither vielfach diskutiert worden ist, weil sie ein scheinbar perfektes Bild für die Beziehungen bereitstellt, die in – vor allem literarischen – Texten herrschen. Denn kein Text hat seinen Ursprung in sich selbst. Immer schon gibt es ältere Texte, von denen er ausgeht, auf die er sich bezieht und die er zitiert. Julia Kristeva hat dieses Verhältnis als das von pheno-Text und geno-Text beschrieben. Der eine, der pheno-Text liegt an der Oberfläche, er tritt uns als Phänomen gegenüber. Darunter liegen jedoch verschiedene Schichten von weiteren Texten, aus denen er entstanden ist, auf deren Grundlage er geschaffen wurde oder die er zitiert. Bei einem Zitat wird der geno-Text – wie der alte Text bei Pergamenten – wirklich sichtbar, zumindest teilweise. Bei anderen Formen von Intertextualität muss er interpretativ erschlossen werden.
Schmidts Bilder stehen quer zu Kristevas Gliederung des Palimpsests. In Arbeiten, die auf Grundlage von Fotografien entstanden sind, die Schmidt gemacht hat, gibt es tatsächlich so ein Verhältnis wie das von pheno-Bild und geno-Bild – nur, dass das geno-Bild in der Regel nicht sichtbar wird, weil es gar nicht gezeigt wird, sondern im Verborgenen bleibt, im Fotoarchiv des Künstlers. In den Übermalungen bilden die Fotografien indes nicht mehr nur die Grundlage, im Ausgang von der das Bild geschaffen wird; sie sind vielmehr genauso sichtbar wie dieses. Sie treten aber nicht nur als Fragment in Erscheinung, wie bei einem Zitat, sondern im Ganzen.
Damit heben sie ein besonderes Merkmal von Palimpsesten hervor, das oft erst in Interpretationen zutage tritt, nämlich den Wettstreit zwischen pheno-Text/Bild und geno-Text/Bild, also der phänomenalen und genetischen Ebene des Werkes. Dieser Wettstreit macht auf drei Aspekte aufmerksam, die für Schmidts Arbeiten wichtig sind.
Erstens: Es gibt keinen Ursprung im Sinne eines Anfangs, vor dem nichts gewesen wäre, sondern immer nur die produktive Auseinandersetzung des schon Vorhandenen. Schmidts Bilder gehen immer schon von anderen Bildern aus, denen, die der Künstler im Kopf hat, wenn er auf Reisen geht, die er sieht, wenn er sich umschaut, die er dazu assoziiert, die er fotografiert und so weiter.
Mithin gibt es, und das ist der zweite Aspekt, auch keine Autorität, die entscheiden könnte, welches Bild oder welche Bildschicht die „eigentliche“ oder wichtigste ist, oder die eine Hierarchie unter den Bedeutungen stiften könnte, die eine Arbeit anbietet. Es gibt nur ein Palimpsest verschiedener Bilder, die durcheinander hindurch scheinen und immer tiefer reichen, ohne je an einen Ursprung zu kommen, und es gibt nur ein Netz unterschiedlicher Bedeutungsknoten, dem wir (gleich einem Netz aus Hyperlinks) folgen können, aber keinen ursprünglichen oder eigentlichen Sinn. Schmidts Arbeiten sind hochgradig ambivalent.
Mit der Schichtung der Bilder ist drittens eine besondere Zeitstruktur verbunden, insofern die Bilder nicht nur einen Moment in der Zeit zeigen bzw. einen Augenblick festhalten, wie Lessing gesagt hatte, sondern die Vergangenheit scheint in die Gegenwart hindurch und andersherum. Diese Nicht-Zeitgenossenschaft mit sich selbst, wie Jacques Derrida das genannt hat, erzeugt eine gespenstische Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart und (in Schmidts Fall) der Gegenwart in der Vergangenheit – denn, anders als in klassischen Palimpsesten sind in Schmidts Bildern pheno- und geno-Bild eben nicht zu trennen.
Diese Überlagerung der Zeitschichten macht das Palimpsest der menschlichen Erinnerung bzw. dem menschlichen Bewusstsein vergleichbar, wie Thomas de Quincey und Sigmund Freud angemerkt haben, beleuchtet aber auch noch einmal den Reisetagebuch-Charakter der Bilder für Schmidt, weil sie gleich Hieroglyphen der Rückerinnerung nicht nur das Gesehene und Erfahrene festhalten, sondern auch den produktiven Umgang damit.
Das macht die Übermalung der Fotos mit der Übermalung von Zeitungen vergleichbar, die Schmidt seit vielen Jahren betreibt. Zuletzt ist eine Serie von Bildern entstanden, die der Künstler auf Sri Lanka gemalt hat, wo er von März bis April 2022 eine Residency hatte. Die Situation empfand Schmidt als skurril: Während er bei frischem Ingwertee in seinem Künstler-Resort saß, die Tage mit privaten Yogastunden, Badevergnügen, Spaziergängen und fotografieren verbrachte, erreichten ihn auch dort die Nachrichten vom russischen Überfall auf die Ukraine. Zugleich rückten mit der Stationierung im indischen Ozean auch andere Krisenherde in den Blick, wie z.B. die Bedrohung der für die westlichen Wirtschaft wichtigen Seewege durch chinesische Expansionsbestrebungen. Schmidt verarbeitete diesen Widerspruch zwischen der splendid isolation im Künstler-Resort und der prekären Weltlage, über die ihn die Tageszeitungen unterrichteten, indem er diese Zeitungen mit Bildern übermalte, zu denen er sich von Fotos inspirieren ließ, die er auf seinen Spaziergängen um das Resort und im Resort gemacht hatte. So entstand eine Serie von Bildern, die Motive des privaten Lebens auf der Insel über Nachrichten vom politischen Leben in der Welt legen und Palimpseste bilden, in denen sich nicht pheno- und geno-Bild überlagern, sondern verschiedene phänomenalen Ebenen des Lebens bzw. Erlebens. Beide kontaminieren sich gegenseitig: Die Intimität und Individualität der Malerei wird vom Weltgeschehen kontaminiert, das Weltgeschehen von der intimen Skizze. So vermengt sich das Bild eines Wasserträgers mit Nachrichten von politischen Reaktionen auf die drohende Energiekrise, die Skizze eines sitzenden Mannes mit Neuigkeiten über einen Wirtschaftsgipfel zur Bekämpfung der Finanzkrise oder die Darstellung eines Radfahrers mit einem Bericht über den Erfolg der pakistanischen Nationalmannschaft im Cricket.
Das Palimpsest macht aus den individuellen Malereien soziale Arbeiten, denn es zeigt das Politische als Grund des Individuellen und das Individuelle als Grund des Politischen. Und es zeigt, dass es kein Retreat gibt, in dem uns die Welt nicht erreichen würde. Jede noch so schöne Isolation ist immer schon mit dem Weltgeschehen vermengt. Jedes Glück wird vom Unglück kontaminiert.
Dagegen stemmen sich die Palmen-Bilder als Explosionen der Farbe und Freude. Auch sie sind Übermalungen von Fotos, nur sieht man das bei ihnen kaum, weil die Farbe so kraftvoll, dicht und dick aufgetragen worden ist. Damit entsteht eine fast reliefartige Struktur von höchster Plastizität, in der sich nicht nur das Licht spiegelt, sondern auch die Dynamik und der Gestus des Künstlers, dessen Lust am Fleisch der Malerei sich auf den Betrachter überträgt und in ihm fortwirkt zum Eindruck, beinahe selbst in der Sonne Sri Lankas zu stehen, im tropischen Wald, die Affen schreien und den Dschungel singen zu hören.
Aber eben nur beinahe, denn Schmidts tropische Feste der Farbe sind zu schön, um wahr zu sein, und der genauere Blick errät den profanen Untergrund unter der Illusion höchstem Lebens. Schmidts Bilder sind künstliche Paradiese. Egal wie hoch die Krone steigt, auf ihrem Grund schwimmt immer ein Schlückchen Melancholie.
Das wäre auch eine Perspektive auf Schmidts Filme „fine“ und „Inizio“, die Schmidt als Gast der Villa Massimo gedreht hat. In „Inizio“ spazieren ein jüngerer und ein älterer Mann (Schmidt) durch Rom. Der ältere scheint den jüngeren zu verfolgen, tut ihm nach. So gelangt er in einen Garten, legt seinen dunklen Anzug ab, wird in weiße Gewänder gekleidet und mit bunten Tüchern umhängt. Er tritt in eine Gemeinschaft ein, die den Garten bestellt, tanzt, meditiert und einer Lehrerin lauscht. Seine Hauptbezugsperson bleibt jedoch der junge Mann.
Die Ikonographie des Films schließt an die Bildtradition des hortus conclusus an, eines verschlossenen Gartens, den die mittelalterliche Gartenbaukunst und die christliche Ikonologie geprägt haben, insbesondere die Marienverehrung. Eine der bekanntesten Darstellungen in der Kunst ist Fra Aneglicos „Verkündigung“ (1430-1432), es gibt aber auch hunderte andere. Sie zeigen Maria in einem verschlossenen Garten und Maria als verschlossenen Garten. Der hortus conclusus ist ein von der Welt abgeschlossener, klösterlicher Ort des Rückzugs und der Besinnung, in dessen Mitte eine Quelle seht, die die Quelle des Lebens symbolisiert. Maria ist auch ein ummauerter Garten, weil sie – als Mutter von Jesus Christus dem Erlöser – die Quelle des Lebens ist und weil sie diesen durch den Heiligen Geist empfangen hat, also ohne dass ihr Leib dafür physisch penetriert und geöffnet worden wäre. Auch der Paradiesgarten wird als ummauerter Garten vorgestellt und es ist die Ummauerung des Gartens, die ihn zum Paradies oder paradiesisch macht.
In Schmidts Film rückt der Bezug des älteren Mannes auf den jüngeren diesen in die Nähe Mariens und gibt so eine dezente Anspielung auf die erotische Orientierung des Künstlers, die immer wieder Thema seiner Arbeiten ist. Die Beziehung der beiden im Film ist jedoch ambivalent. Denn es kommt immer wieder zu Angriffen des alten auf den jungen. Er schubst ihn unvermittelt in den Staub, schließlich ringt er ihn nieder und würgt ihn.
Am Ende des Films gleitet er – wieder im dunklen Habit – zufrieden mit seinem E-Scooter durch die Straßen Roms. Er hat das Paradies verlassen. Die christliche Ikonografie im Untergrund des Films legt es nahe, an den Sündenfall, die Vertreibung aus dem Paradies oder auch an den Brudermord Kains zu denken, der Abel erschlug. Die Spontaneität, scheinbare Willkür oder auch Freiwilligkeit, mit welcher der Alte die Wende einleitet, erinnert aber eher an einen Ausbruch als an einen Rauswurf und nimmt damit eine kritische und individualistische Position gegenüber dem christlichen Subtext ein.
Dieser Subtext versteht die Sünde als Abkehr von der göttlichen Ordnung. Das ist schon bei Augustinus so und setzt sich – säkularisiert – über die Aufklärung bis in die Moderne fort. Sündhaft oder moralisch falsch ist das Handeln, das sich nicht der allgemeinen Ordnung unterwirft, ganz gleich, ob diese Ordnung in der christlichen Heilslehre oder vom kategorischen Imperativ formuliert wird, der bekanntlich fordert so zu handeln, „daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne“ (KpV A 54).
Im Hintergrund dieser Auffassung stehen Entlastungsstrategien. So versucht z.B. Augustinus die Perfektibilität der Schöpfung zu retten, indem er den Ursprung des Übels in der Welt außerhalb der Schöpfung verortet, nämlich in der Freiheit. Satan, so Augustinus, habe die Freiheit gehabt, sich der göttlichen Schöpfung zuzuwenden, oder sich auf sich selbst zu beziehen und sich von ihr abzuwenden. Satan hat sich für letzteres entschieden und damit das Muster für die Sünde gegeben. Die Sünde beginnt mit dem Selbstbezug, dem Nutzen der eigenen Freiheit nicht für das Allgemeine, sondern für sich selbst. Beim Menschen wiederholt sich das. Auch er ist frei, sich so oder so zu entscheiden und wenn es in der Welt Übel gibt, dann spricht das nicht gegen die Perfektibilität der Schöpfung, sondern liegt daran, dass Menschen sich in ihrer Freiheit dazu entscheiden, im Widerspruch zur göttlichen Ordnung zu handeln. Die Sünde ist „ein Wort, eine Tat oder ein Begehren im Widerspruch zum ewigen Gesetz“; in ihr wirkt die „bis zur Verachtung Gottes gesteigerte Selbstliebe“. Sie ist das Zeichen einer „stolzen Überheblichkeit dem Gehorsam Jesu“ gegenüber. Diese Auffassung wirkt über die Aufklärung bis heute fort, insofern der einzige moralisch einwandfreie Gebrauch der individuellen Freiheit darin bestehen soll, sich an einem allgemeinen Gesetz zu orientieren, wie etwa Kant geschrieben hat, und der Grund für die – trotz fortgeschrittener Aufklärung – immer noch bestehenden Übel im falschen Handeln von Menschen gesehen wird, die sich freiwillig dazu entschieden haben, in einer Weise zu handeln, die dem allgemeinen Gesetz oder der allgemeinen Wohlfahrt widerspricht.
Man kann das, wie Peter Sloterdijk, als Entlastung verstehen, insofern nicht mehr, wie bei Augustinus, die Freiheit des Menschen per se sündhaft resp. moralisch verwerflich ist, sondern nur noch so ein Gebrauch der individuellen Freiheit, der das Allgemeinwohl nicht befördert, aber es bleibt doch eine Überlastung des Subjekts, das mit der atlantischen Aufgabe beschwert wird, die Perfektibilität der Schöpfung bzw. die Vernünftigkeit der Weltorganisation zu retten, indem es die die Verantwortung für die Übel der Welt übernimmt und sich im Konflikt zwischen seinen individuellen Wünschen und dem allgemein Vernünftigen für letzteres entscheidet. Das heißt aber in Konsequenz, sich der individuellen Freiheit zu begeben. Denn eine individuelle Freiheit, die sich im Konfliktfall immer einem höheren Allgemeinem unterordnen muss, ist keine Freiheit.
So gesehen sind die „großen Verbrecher“ (Friedrich Schiller) Freiheitskämpfer. Sei beharren auf ihrer individuellen Freiheit gegenüber dem allgemeinen Gesetz. In John Miltons „Paradise Lost“ sagt Satan nach seinem Höllensturz:
„Ist dies der Wohnsitz, der uns statt des Himmels
Zuteil wird, trauervolle Dämmerung statt
Wie einstens Götterlicht? So sei’s denn,
Da er, der jetzt der höchste ist, bestimmt,
Was recht sein soll: je weiter weg von jenem,
Um so viel besser, der vernunftgemäß
Uns ebenbürtig, den Gewalt allein
Zum Herren über Seinesgleichen machte.
(…)
Lebt wohl ihr seligen Gefilde, wo
Freude ewig wohnt: willkommen Schrecknis
Der Unterwelt, willkommen tiefste Hölle,
Empfange deinen neuen Eigentümer,
Dem Ort und Zeit den Geist nie werden ändern.
Der Geist ist selbst sein eigner Ort, und macht
Aus Himmel Hölle sich und aus Hölle Himmel.
(…)
Hier werden frei zum mindesten wir sein.
Hier hat die Allmacht nicht aus Neid gebaut,
Und treibt uns nicht mehr fort. Wir herrschen hier
In Sicherheit, und wenn’s nach mir geht, so
Sei’s in der Hölle herrschen lohnt sich immer:
Zu herrschen in der Hölle hier ist mir
Lieber, als in dem Himmel nur zu dienen.“ S. 14f. Buch 1, Verse 280 bis 305)
Lieber in der Hölle Herrscher, als im Himmel Diener sein! Mit dieser Geste cruised Schmidts Alter (ego) durch Rom und reiht sich damit ein in die lange Reihe der advocati diaboli von Miltons Satan bis Niklas Luhmann – wenngleich die Verteidigungsstrategie des Soziologen natürlich etwas differenzierter ist als das „Ich will aber“ der großen Verbrecher.
Was nämlich, wenn – und Luhmanns Beschreibung spricht dafür – die Teilsysteme moderner Gesellschaften in ihren Funktionen derart differenziert sind, dass sich gar nicht abschätzen ließe, wie sich das individuelle Verhalten zur allgemeinen Wohlfahrt verhielte, weil jedes System nach einem eigenen Code funktioniert und in seiner zyklopischen Einäugigkeit das, was in anderen Systemen geschieht, nur als Rauschen einer Umwelt wahrnimmt, die es nicht verstehen, sondern nur in seinen Rückkopplungen spüren kann, und es mithin keine Instanz gibt, von der aus es möglich wäre, auch nur die Konsequenzen einer einzelnen Handlung in einem Gesamtzusammenhang abzuschätzen? Könnte dann von diesem Subjekt überhaupt noch erwartet werden, sein Verhalten an der allgemeinen Wohlfahrt auszurichten? Wohl kaum, denn wenngleich es bestenfalls die Konsequenzen seines Handelns in einem System abschätzen kann, kann es doch nicht wissen, welche Rückkopplungen das in anderen Systemen erzeugt, noch, was der allgemein, also für alle Teilsysteme beste Zustand wäre. Ich kann z.B. abschätzen, welche Konsequenzen es im System Wirtschaft hat, wenn ich das Bier, das ich möchte, nicht bezahle. Denn, da dieses System nach dem Code zahlen/ nicht zahlen funktioniert und darüber knappe Güter distribuiert, kann ich davon ausgehen, dass ich kein Bier bekomme, wenn ich nicht bezahle. Welche Auswirkungen meine Zahlung oder Nichtzahlung auf das Wetter, die Wissenschaft, das Rechtssystem oder die Politik hat, kann ich indes nicht abschätzen, noch wüsste ich zu sagen, ob es im Sinne des Allgemeinwohls besser oder schlechter ist. Ich kann mich nur an meine individuellen Wünsche halten und an meine Möglichkeiten: Möchte ich noch ein Bier oder nicht? Und kann ich es bezahlen oder nicht? Ich kann mich also, philosophisch gesprochen, nur auf mich selbst beziehen, und damit das tun, was mir mit die christliche oder aufklärerische Theodizee verbietet, weil die funktionale Differenzierung der Gesellschaft, in der ich lebe, die Ausrichtung nach einem allgemeinen Gut unmöglich macht. Diese Einsicht befreit das Subjekt von der atlantischen Aufgabe, in seinem eigenen Handeln die Verantwortung für die Übel der Welt oder noch nicht hinreichend gute Weltverhältnisse übernehmen zu müssen, gibt dafür aber eben auch die Idee einer Perfektibilität der Gesellschaft preis. Das Paradies ist verloren, die Freiheit indes gewonnen – keine Freiheit zu, aber eine Freiheit von, nämlich eine Befreiung von der Überlastung des Subjekts, die die Theodizeen ihm auferlegen.
Das macht das Leben profaner. Davon erzählt der Film „fine“. Ein Mann (Schmidt) betritt eine Kirche, verbrennt seinen Mantel und bestreicht seinen schwarzen Anzug mit der weißen Asche. Er ist „Durchschnitt“, wie er sagt, hat seine hochfliegenden Pläne aufgegeben. Er zieht durch die engen Gassen von Olevano Romano, einer Außenstelle der Villa Massimo, und steigt zur Terrasse der Casa Baldi empor. Volleyballerinnen werden gegengeschnitten. Sie holen ihn ein und bestürmen ihn mit ihrem Ballspiel. Schließlich bricht er unter ihren Schmetterbällen zusammen. Wieder zu sich gekommen steht er in weißer Unterwäsche auf der Terrassenbrüstung und begießt sich mit Olivenöl. Der Film gipfelt in diesem Schlussbild.
Fellini, an dessen Ästhetik „fine“ anschließt, hatte davon geträumt, „aus einem Film ein Gemälde zu machen. (…) Das Ideal wäre, einen Film aus einem einzigen Bild zu machen, das ewig feststeht und voller Bewegung ist.“ Schmidts Film strebt am Ende auf so ein Bild zu, es zeigt den von der atlantischen Last befreiten, unheroischen und profanen Menschen.
Und die Malerei? Mit ihr verhält es sich vielleicht doch noch einmal etwas anders. Denn auch dann, wenn wir moderne Gesellschaften so beschreiben, dass sie sich in verschiedene Systeme ausdifferenzieren, die in sich geschlossen sind und ihre Umwelt nur als Rauschen wahrnehmen, kann die Malerei diese funktionale Differenzierung in ihrer Abbildung doch überwinden. Schmidt fotografiert verschiedene Systeme und malt darüber. Er legt seinen Duktus über die Abbildungen verschiedener Systeme und vereint diese in seiner Malerei. In der Kunst wird ihre Differenzierung aufgehoben. Alles verbindet sich.
Könnte jetzt nicht die atlantische Aufgabe wieder an den – ästhetisch erzogenen – Menschen gestellt werden? Mitnichten, denn die von der Kunst geschaffenen Synthesen sind rein artifiziell. Es sind nur noch künstliche Paradiese, die ihre Scheinhaftigkeit nicht nur nicht verbergen, sondern allein deshalb so hell leuchten, weil sie nur Schein sind, schönes Gaukelspiel von Licht und Schatten, Farbe und Kontur. Das verleiht ihnen einen melancholischen, oder, wie Friedrich Schiller gesagt hätte, sentimentalischen Charakter. Sie stellen das Paradies als ein immer schon verlorenes vor, das nur in der ästhetischen Imagination noch einmal heraufbeschworen werden kann. Aber dieser Verlust nimmt eine große Last von unseren Schultern – und das macht ihn doppelt schön.
Björn Vedder
Julia Kristeva, „L’engendrement de la formule“, Semiotike. Recherchen pour une sémanalyse, Paris 1969, S. 216-310, hier: 224ff.
Augustinus, Contra Faustum manichaeum, 22, 27: PL 42, 418; vgl. KKK, 1849. Augustinus, De civitate Dei, 14,28. vgl. Phil 2,6-9. KKK, 1850.