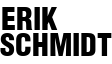Heimatfilme ohne Heimat
(von Roland Nachtigäller)
Rückkehr in die Heimat – eigentlich ein Topos von beinahe unerträglicher Sentimentalität. Und dennoch besitzt das Thema jenseits aller Kitschromane, Heimatfilme und Homestories eine jeweils individuelle biographische Dramatik, die nicht einfach beiseite zu schieben ist. Vor allem mit Blick auf die Künstlerkarriere steckt in diesem Thema noch eine ganz besondere Dynamik, wenn das Betreten eines unsicheren Terrains der Auseinandersetzung, was eine ernsthafte künstlerische Arbeit fast a priori bedeutet, abgeglichen werden muss mit dem Verlassen eines vertrauten, freundlich gesinnten Umfelds. So interessieren sich eben gerade auch Künstler, ob nun bildende oder darstellende, für solcherart Aufbruchs- und Rückkehrbewegungen, die eng damit verbunden sind, dass die eigene künstlerische Arbeit fast immer auch eine Art Selbsterkundung ist, eine Befragung eigener Energien und Kräfte, die sich nun einmal unzweifelhaft aus den Wirren individueller Lebenswege speisen.
Es verwundert daher nicht, dass Künstler ungeachtet aller Untiefen fast zwangsläufig immer wieder Bezug nehmen auf die eigenen Wurzeln, auf Einflüsse, Erfahrungen, Prägungen und biographische Zusammenhänge, die das Ich, wie wir wissen, so nachhaltig prägen und deren tatsächliche Bezüge zur aktuellen Persönlichkeit, deren nachweisbare Relevanz für die Konstitution letztlich so interpretationsabhängig bleibt. Es sind gerade das Maß an Souveränität, das Bewusstsein darüber, was man tut, die Reflexion des Kontextes, in dem man sich bewegt, die hier die Unterschiede zeichnen zwischen peinlicher Selbstbespiegelung und geradezu notwendiger Erkundung der eigenen Bedingtheit.
Wenn also Erik Schmidt fast 15 Jahre nach seinem Aufbruch aus dem Ostwestfälischen auf künstlerische Weise spürbar zweifelnd und vorsichtig tastend jene Themen befragt, die letztlich einen klaren Bezug zur früheren „Heimat“, zur eigenen Biographie haben und unleugbar die individuelle Weltsicht mit prägen; wenn er plötzlich ein Thema wie die Jagd aufgreift, das ein zwar international relevantes, aber eben dennoch aus den eigenen Erfahrungsbezügen motiviert ist – so spiegelt sich darin auch die ebenso faszinierte wie widerständige Befragung künstlersicher Motivationen, die Suche danach, woraus sich das eigene Werk speist, wie viel Grundsätzliches im Individuellen zu entdecken ist. 2004 taucht das „Jagdfieber“ erstmals im Titel einer seiner Einzelausstellungen auf (Brandenburgischer Kunstverein Potsdam) und von dort aus entwickelt und verzweigt sich dieses Auseinandersetzungsfeld in viele Facetten, bis es schließlich 2010 im Konzept der „Westfälischen Splitter“ mündet und dort möglicherweise auch abgearbeitet sein wird.
Mit diesem Projekt wird die biographische Verwobenheit mit einem Thema der künstlerischen Auseinandersetzung nun nicht nur geographisch verortet, sondern auch über ein Höchstmaß an theatralischer Inszenierung explizit formuliert und zugleich mehrfach gebrochen. Erst einmal aber wirft sich Erik Schmidt mit aller Schonungslosigkeit in das Schlachtfeld dieser emotionalen, biographischen und künstlerischen Verstrickungen. Allein das Format der Trilogie gibt sich hochgradig symbolisch aufgeladen, als zentrales Medium wird der offene narrative Kurzfilm gewählt, der Künstler selbst schlüpft in die Hauptrolle einer jeden Erzählung, Kulissen, Staffage und Darsteller stammen unübersehbar aus dem heimatlichen Kontext, während die in den jeweiligen Teilen bearbeiten Themen pathetischer nicht sein können: Jagd und Leidenschaft, Krankheit und Wahnsinn, Tanz und Tod – allesamt festgemacht an der tragischen Figur des bürgerlichen Künstlers ganz in Thomas Mann’scher Tradition, umrankt von Adel und (Homo-)Erotik, Etikette und Dekadenz.
Erik Schmidt ist sich dabei in jedem Moment bewusst, dass er hier auf hochgradig vermintem Gelände agiert, und erklärt dennoch die unerbittliche Notwendigkeit dieser Auseinandersetzung: „Das Projekt führt meine Auseinandersetzung mit der Figur des bürgerlichen Künstlers fort, welcher sich seit Anfang des 19. Jahrhunderts mit den europäischen Nationen und deren Bürgertum entwickelte. Seit 1998 habe ich mich mit diesem Archetyp filmisch auseinandergesetzt. [„I love my hair“ ist schon von 1997! wo sieht er den Beginn, erst bei „Wenn Kunst zu Pop wird …“? Anmerkung RN] Da ich Maler bin, entsprechen meine Person sowie meine Rolle in der Welt dieser Projektionsfläche. Das Genre, von dem meine Arbeit ausgeht und in dem ein Großteil meiner Produktion stattfindet, ist auch heute noch der zentrale Projektionsraum bürgerlicher Künstlermythen und Genieanbetungen. Sie weise ich nicht zurück, sondern ich versuche vielmehr ihren antagonistischen und hierin auch produktiven Charakter in der Gegenwart zu markieren“ (aus einem Projektpapier für Marta Herford im Sommer 2009).
Gelingen kann dies nur, indem Erik Schmidt eben gerade nicht in unterkühlter Distanz zu seinen Themen und Projektionsfeldern tritt, sondern im Gegenteil die darin enthaltene Theatralik, Stilisierung und Platitüdenhaftigkeit bis ins Extrem steigert und aufheizt. Die für eine produktive Auseinandersetzung aber dennoch unvermeidliche Distanzierung geschieht bei ihm durch eine Art von Überhöhung, die zwangsläufig zum Sockelsturz führt, eine emotionale Aufladung, die für jeden sichtbar ins Ironische kippt und die dargestellten Gefühle, Bewegungen und Referenzen als ein großes Arsenal der Versatzstücke desavouiert, die ungeachtet ihrer Realitätsbezüge die grundsätzliche Gebrochenheit einer möglichen Selbst-„Erkenntnis“ thematisieren. So sind die Filme „Hunting Grounds“ (2006), „Bogged Down“ (2009) und „Gatecrasher“ (2010) kindliches Spiel und bitterer Ernst zugleich, ebenso zweifelnde wie faszinierte Erkundungszüge in die eigene Biographie, lustvoll dekonstruierende und heillos suchende Konfrontationen mit der eigenen Künstlerrolle zwischen den erstarrten Plattitüden des 19. Jahrhunderts und den fluktuierenden Identitäten der Gegenwart.
Es ist das große Verdienst Erik Schmidts, dieses individuelle Sentiment in einer Weise zu generalisieren, dass aus einer persönlichen Suche plötzlich eine allgemeine Relevanz entspringt, die eben nicht als kühle Analyse oder mit sarkastischer Kritik die Parallelität unterschiedlicher gesellschaftlicher Welten beschreibt, sondern mit ironisierender Leichtigkeit die Unlösbarkeit dieser Gleichzeitigkeit und Widersprüchlichkeit inszeniert. Gerade indem Schmidt ohne festes Drehbuch arbeitet, mit hoher technischer Professionalität die Improvisation am Set provoziert, indem er die filmischen Stilmittel zum Teil offen zeigt und als Referenzsystem sichtbar werden lässt, indem es ihm gelingt, sich selbst und Menschen des regionalen öffentlichen Lebens zum Ensemble seiner Filme zu machen, öffnen diese Arbeiten einen Raum der Reflexion, der sich fast schlafwandlerisch auf der schmalen Linie zwischen Erkenntnis und Absturz, zwischen Sentimentalität und Großartigkeit, zwischen leidenschaftlicher Präzision und schrillem Klamauk bewegt. In allen drei Filmen widmet sich Erik Schmidt großen humanistischen Bildungsthemen des Bürgertums, die im 21. Jahrhundert eigentlich so veraltet wie überholt erscheinen und dennoch allgegenwärtig die gesellschaftliche Realität prägen. Allein am Beispiel der Jagd – aber es ließe sich auch mit Leichtigkeit auf Themen wie gesellschaftlicher Stand, Krankheit und Heilung, Geschichte und Tradition übertragen – wird offensichtlich, wie stark sich der Künstler mit vollem Risiko verstrickt in Faszination und Befremden, Anerkennung und Nichtzugehörigkeit, Leidenschaft und Abhängigkeit. Eben weil er diese Themen und ihre Protagonisten nicht denunziert, sondern sie ernst nimmt, die individuelle Verstricktheit und emotionale Verwicklung thematisiert und sie als grundsätzliche Fragen in den Raum gegenwärtiger gesellschaftlicher und künstlerischer Diskurse stellt, bewahrt er sich eine Souveränität, die sich gerade aus dem großen Risiko der persönlichen Involviertheit speist. So entstehen „Heimatfilme“ ohne Heimat, haltlos und rätselhaft, faszinierend und düster, augenzwinkernd und gnadenlos …